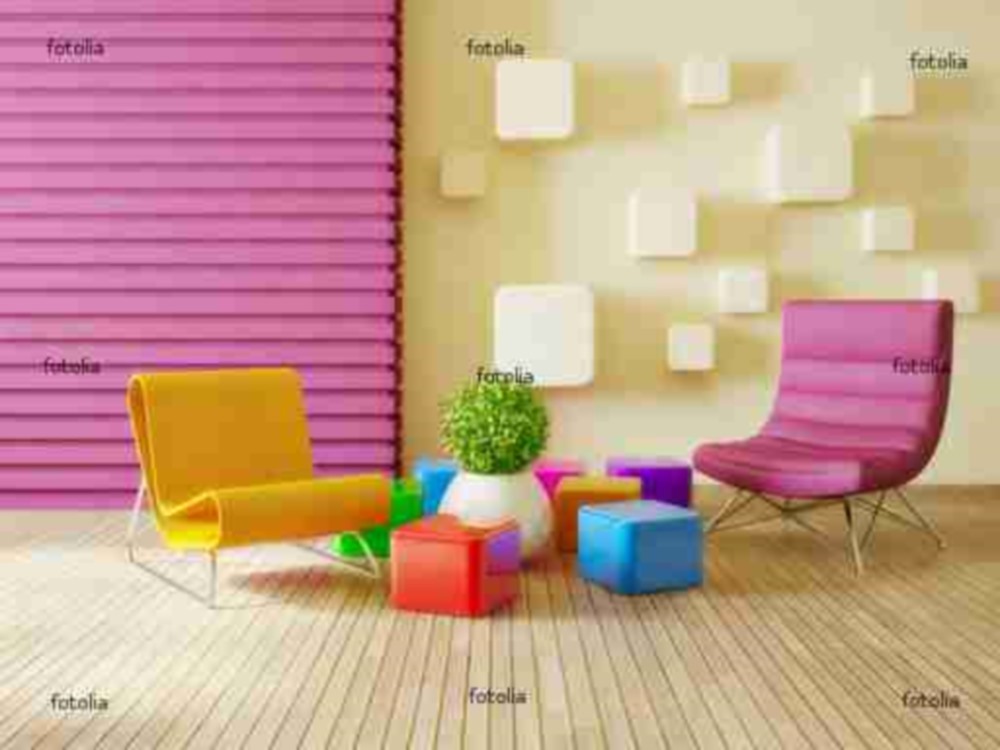Die portugiesische Insel Madeira befindet sich im Atlantik, etwa 1000 km von Lissabon und 800 km von Marokko entfernt. Der Name Funchal bedeutet „viel Fenchel“ und bezeichnet die heutige Hauptstadt der portugiesischen Insel sowie den dazugehörigen Distrikt, der sich im Süden befindet.
Die meisten Besucher erreichen Madeira mit dem Flugzeug. Der Flughafen „Santa Catarina“ liegt im Osten der Insel in unmittelbarer Nähe der Stadt Santa Cruz. Schon der Anflug auf den Flughafen ist sehr speziell und will daher hier erwähnt werden. Lange Zeit galt er als einer der schwierigsten überhaupt, da es aufgrund seiner Lage an einem Steilküstenhang mit gelegentlich auftretenden Schwerwinden sowie einer vergleichsweise kurzen Landebahn immer wieder zu turbulenten Landungen und auch zu schweren Unfällen kam. Nur besonders geschulte und erfahrene Piloten durften die Landungen durchführen. Seit September 2000 gibt es nun eine um 1020 m auf 2777 m verlängerte Landebahn, die mittels eines aufwändigen und imposanten Stützenbauwerks ins Meer hinein gebaut wurde. Es wurden Betonpfeiler von 3m Durchmesser und einer Länge von bis zu 120 m verbaut. Hiervon sind bis zu 59 m oberirdisch, der Rest wurde im Meeresboden verankert. Das Gebäude und die verantwortliche brasilianische Ingenieurgesellschaft, Andrade Gutierrez, erhielten 2004 den „Outstanding Structure Award“ der IABSE. Ebenfalls am Flughafen wird man zum ersten Mal den „Azulejos“ begegnen, den bekannten blauen Kacheln, auf denen Szenen aus dem Leben der Madeirenser dargestellt werden. Sie sind ein Erbe der Mauren, die auch die Architektur auf der Insel geprägt haben und sind sowohl auf der Fassade als auch im Innenraum verschiedenster Gebäude in Funchal zu sehen.
Madeira ist gemeinhin als „Blumeninsel“ des Atlantik bekannt. In der Hauptstadt Funchal, die sich, umgeben von imposanten Bergen, in einer Art Talsenke am Meer befindet, gibt es eine üppige Vegetation und zahlreiche Gärten. Der bekannteste ist wohl der tropische Garten „Nossa Senhora do Monte“, welcher auf dem Berg Monte liegt und den man man per Seilbahn, dem so genannten „teleférico“, erreicht. Für die rasante Abfahrt verwenden Touristen gerne die bekannten Korbschlitten, mit denen sie wieder ins Tal gefahren werden.
Funchal hat aber gerade auch in architektonischer Hinsicht Vieles zu bieten. Wenn man seine Besichtigungstour mit den historischen Gebäuden beginnen möchte, so ist das Viertel Sé im Zentrum von Funchal am Meer sicher ein guter Startpunkt. Dort befindet sich die Kathedrale Sé, genauer „Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção“ in der Rua da Sé. Mit dem Bau der Kirche wurde 1500 begonnen. 1508 wurde sie eingeweiht und 1514 von der Kirche zur Kathedrale erhoben als Funchal zum dritten Bischofssitz Portugals ernannt wurde. Die Kirche verbindet südeuropäischen Gotik mit maurischen und manuelinischen Elementen sowie der lokalen Inselarchitektur. Die Natursteinfassade ist recht schlicht, teilweise weiß verputzt, und wird von einer Turmspitze aus vielfarbigen Kachelschindeln gekrönt. Auf der Apsisseite gibt es schraubenartig gedrechselte Türmchen und eine verschnörkelte Brüstung zu sehen. Im Inneren verbinden zehn gotische Bögen die Kirchenschiffe miteinander. Das vergleichsweise spärliche Tageslicht fällt durch lediglich acht manuelinische Fensterluken, eine Fensterrosette im Bereich des Portals und einige schmale, längliche Fernster über dem Alterraum. Auffällig schön ist die aus dem 16. Jahrhundert stammende Holzdecke mit ihren Elfenbeinintarsien. Die ehemals prunkvolle Einrichtung der Kathedrale ist inzwischen in den Museen der ganzen Stadt verteilt. Von der ursprünglichen Ausstattung sind noch das Taufbecken, die Kanzel und der kleine Hochaltar in der Kirche verblieben. Von hier aus gelangt man in wenigen Gehminuten zum dem etwas weiter nordöstlich gelegenen Rathaus, der „Câmara Municipal do Funchal“. Es befindet sich am gepflasterten Platz „Praca do Municipo“, einem der schönsten Plätze Funchals. Das Rathaus liegt an dessen Stirnseite. Es ist ein Barockpalast aus dem 18. Jahrhundert, den die Stadt im Jahr 1883 einer wohlhabenden Familie abkaufte und bis heute nutzt. Das zweigeschossige Gebäude besitzt ein verziertes in Stein gemeißeltes Eingangsportal und fällt durch die im Obergeschoss mit Balkonen versehenen Fensterreihe auf. Auf der Nordwestseite des Platzes findet man das frühere Jesuitenkolleg mit der beeindruckenden Kirche „Igreja do Colégio“ aus dem 17. Jahrhundert. Die Kirche ist ein prachtvolles Beispiel für die Verbindung des manieristischen und barocken Baustil, den es auf der Insel öfter zu sehen gibt. Heute sind hier Räumlichkeiten der Universität Madeira untergebracht. Direkt gegenüber der Kirche befindet sich außerdem der Bischofspalast der heute das Museums für sakrale Kunst beherbergt.
Funchal war seit jeher Ziel von Piratenübergriffen. 1566 traf es die Stadt besonders heftig. Die damalige Festung konnte den Angriffen nicht standhalten, weshalb man sich nach und nach an verschiedenen Orten in der Stadt verstärkte, so dass man noch heute mehrere Befestigungsbauten besichtigen kann. Ebenfalls im Stadtviertel Sé befindet sich die Festung bzw. der „Palácio de São Lourenço“. Er wurde bis ins 19. Jahrhundert stetig ausgebaut und vergrößert und zählt heute zu den besterhaltensten Beispielen portugiesischer Befestigungsbauten des 16. und 17. Jahrhunderts im maurischen Stil. Aktuell gibt es hier eine Dauerausstellung zur Geschichte der Festung zu sehen, die vom Militärkommando organisiert wird, das neben dem amtierenden Ministerpräsidenten derzeit die Räumlichkeiten nutzt. Eine weitere Festung ist die ockergelbe „Fortaleza de Santiago“, die sich im östlichen Teil der Stadt im Viertel São Pedro befindet und 1614 errichtet wurde. Bis 1922 diente das Fort rein militärischen Zwecken. Seitdem wird es für kulturelle Veranstaltungen genutzt und beherbergt heute das Museum für zeitgenössische Kunst. Die „Fortaleza de São João do Pico“, wurde erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fertiggestellt. Sie liegt auf der 111 m hohen Anhöhe Pico dos Frias und gehört seit dem 20. Jahrhundert der Marine. Seit 1943 steht der gesamte Gebäudekomplex unter Denkmalschutz. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, da man von der leicht erhöhten Position einen guten Blick über Funchal und das Meer hat.
Auf jeden Fall einen Ausflug wert und wahrscheinlich das bekannteste Bauwerk Funchals ist Oskar Niemeyers „Pestana Casino Park“ aus dem Jahre 1976. Es handelt sich hierbei um ein Ensemble aus Casinogebäude, Hotel und 15.000 m² großer Parkanlage mit Jahrhunderte alten Bäumen und typischen Pflanzen der Insel. Das Casino selbst besteht aus kreisförmig gruppierten vertikalen Betonrippen und erinnert damit an einen Vulkan. Im Innenraum beeindruckt es mit seiner Weitläufigkeit und dem Spiel mit dem Tageslicht. Es ist über eine Brücke mit dem dazu gehörigen Hotel verbunden. Das Hotel ist im Erdgeschoss aufgeständert und umgibt das Casino in Form eines Halbkreises.
Wen zeitgenössische Architektur besonders interessiert, dem ist ein Ausflug ins nahe gelegene Calheta zu empfehlen. Dort kann man ein Werk des erfolgreichen Architekten Paulo David, der in Funchal geboren wurde und auch heute hier lebt und arbeitet, besichtigen: das Kunstzentrum „Casas das Mudas“. Es handelt sich hierbei um ein aus heimischem Vulkangestein erbautes Kunstzentrum einschließlich Museum für moderne Kunst. Das Gebäude ist direkt an einer steil abfallenden Klippe erbaut worden. Der Besucher betritt es über das Dach und steigt dann bis zu 3 Stockwerke hinab. Dabei scheint das Museum mit seiner Umgebung zu verschmelzen – zum einen wegen der verbauten heimischen Materialien, zum anderen wegen der beeindruckenden Ausblicke auf den Atlantik, die es bietet. Hierfür wurde Paulo David 2004 für den Mies van der Rohe Preis nominiert.
Es zeigt sich also, dass die „Blumeninsel“ Madeira in Funchal auch Kultur- und Architekturinteressierte nicht zu kurz kommen lässt – und das, dank des durchgängig milden Klimas, praktisch das ganze Jahr.
Autorin: Eva Kruse-Bartsch